| |
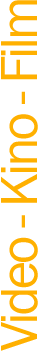 |
|
| Z |
|
Kritik aus der 
Kritik aus den 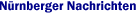 |
 |
 Am Ende Am Ende
der Gewalt
Der neue Wim
Wenders: Helden der Tele-
kommunikation in einem rätselhaften Krimi
|
 |
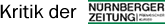 A A Im
Kino, diesem Himmel auf Erden, werden die
Toten wieder lebendig, und zu den wenigen
wirklich berührenden Szenen in Wim
Wenders' neuem Film gehören zumindest
die Auftritte von Sam Fuller. Da ist das
Rauhbein unter den amerikanischen
Regisseuren, erst vor kurzem verstorben,
noch einmal zu sehen. Ein alter, schon
etwas müder Krieger, der die Zigarre
bereits abgelegt hat (vom Revolver ganz
zu schweigen) und ziemlich genau weiß,
daß er den letzten Kampf nicht gewinnen
wird. Schwach, aber verschmitzt, tippt er
auf seiner mechanischen Schreibmaschine
herum, von der er sich auch in modernen
Zeiten nicht trennen will: eine kleine,
große Geste gegen den Stand der Dinge.
Mach's noch einmal, Sam. Im
Kino, diesem Himmel auf Erden, werden die
Toten wieder lebendig, und zu den wenigen
wirklich berührenden Szenen in Wim
Wenders' neuem Film gehören zumindest
die Auftritte von Sam Fuller. Da ist das
Rauhbein unter den amerikanischen
Regisseuren, erst vor kurzem verstorben,
noch einmal zu sehen. Ein alter, schon
etwas müder Krieger, der die Zigarre
bereits abgelegt hat (vom Revolver ganz
zu schweigen) und ziemlich genau weiß,
daß er den letzten Kampf nicht gewinnen
wird. Schwach, aber verschmitzt, tippt er
auf seiner mechanischen Schreibmaschine
herum, von der er sich auch in modernen
Zeiten nicht trennen will: eine kleine,
große Geste gegen den Stand der Dinge.
Mach's noch einmal, Sam.
Man muß, unweigerlich,
an all die anderen dahinschwingenden
Väter und Vorbilder von Wenders denken,
an Nick Ray in „Lightning over
water“, an Curt Bois in „Der
Himmel über Berlin“ oder Heinz
Rühmann in „In weiter Ferne, so
nah!“. Bei Sam Fuller ergeben sich
jedoch, ebenso unweigerlich, Bezüge zu
einem Kino, das, gerade wenn es von
Gewalt handelt, ganz aus dem Bauch kommt
und dem Schrecken mit unbekümmerter
Ambivalenz auch seine Schönheit
zugesteht. Die Kraft, die es so erzeugt,
kann man bei Wenders' Kopfgeburten
dagegen nur vermissen. Wenders denkt
zuviel und zeigt zuwenig: so bleibt
„Am Ende der Gewalt“ ein
ermüdender Essay, der sein Thema nur aus
sicherer Distanz behandelt, blutarm und
gedankenblaß.
Es geht, wie meist bei
Wenders, vor allem um das Machen von
Bildern und ihre Macht, die Gefahr des
Mißbrauchs und die Manipulation in
unseren Hirnen. Zwei Männer erkennen den
Zusammenhang und ändern sich, ihr
bisheriges Leben findet dadurch, so oder
so, ein Ende. Mike Max (Bill Pullman),
Produzent von Filmen, in denen Gewalt
für Gewinn an der Kasse sorgt, thront
mondän über den Hügeln von Los
Angeles, kommuniziert nur noch via
Computer und kämpft nebenher um seine
Ehe. „Ich werde dich
verlassen“, haucht Andie MacDowell
als gelangweilte Gattin ins Handy und
fährt sich leidend durchs Haar –
doch das Problem löst sich anderweitig.
Mike wird entführt und wandelt sich
unter freundlichen Mexikanern zum neuen
Menschen, gärtnernd und grundgut.
Ray Bering (Gabriel
Byrne) ist der andere Pol des Films: ein
Programmierer, der von seinem
Observatorium aus nicht in die Sterne
schaut, sondern in die Straßen der
Stadt, und für das FBI eine
flächendeckende Videoüberwachung
installiert hat. Als er wahrnimmt, daß
jede Kamera auch eine Waffe darstellt
(und dies nicht nur metaphorisch), steigt
er ebenfalls aus: das hätte man sich
durchaus spannend vorstellen können.
Wenders aber (und sein Autor Nicholas
Klein) langweilen mit fader
Personenführung und diffusem Plot,
platten Nebenfiguren und nicht
nachvollziehbarer Psychologie. Die
visuelle Eleganz kann die fehlende
Energie hinter den Bildern nicht
ersetzen.
„Warum dreh ich
überhaupt in Amerika? Ich hätte in
Europa bleiben sollen“, sagt sich
Udo Kier als Regisseur in „Am Ende
der Gewalt“. Das ist als Scherz
gemeint, aber für Wim Wenders gilt
traurigerweise nichts anderes.
|
|
 |
Es ist gar nicht
so sicher, ob die Filmemacher immer den
Symbolgehalt ihrer eigenen Bilder bestimmen. Als
Wim Wenders nach der Europa-Premiere seines
Hollywood-Essays „Am Ende der Gewalt“
in Hof die übriggebliebenen Zelluloid-Schnipsel
wie Lotto-Lose ans Publikum verteilte, war die
Wirkung rührend. Ein international anerkannter
deutscher Regisseur versteht sich auf die Kunst
des Souvenirs: Endgültig Abschiednehmen vom
Autorenfilmer, der jetzt – wieder einmal
– ins Industrielabor Kaliforniens
zurückgekehrt ist.
Dort arbeitet man nicht auf
eigene Faust und läßt sich nicht staatlich
fördern. Dort ist es aber möglich, versponnene
Puzzle-Spiele zu inszenieren, von denen man auch
in zweiter Fassung nicht alles versteht. Wim
Wenders, der seine Filme immer gern verrätselt
hat, bringt es damit zu höchster
Kritiker-Aufmerksamkeit. Ausschweifige
Betrachtungen befassen sich mit seiner Ästhetik,
untersuchen die Karriere-Knicke und verteidigen
den dauerhaften Anspruch aufs Avantgardistische.
Beim Stand der Dinge ist
Wenders nun als Sinnstifter geoutet worden.
„Wie soll man leben?“ oder „Wie
leben wir?“ sind Fragen, die nach wie vor im
Kino ihren Platz haben. „Auch mit digitalen
Effekten und in Dolby Stereo“, sagt der
Künstler. Sein Alter ego im neuesten Film heißt
Mike Max (Bill Pullman), ist Movie-Tycoon mit
Wahnsinns-Villa in Malibu und einer
elektronischen Ausrüstung, die
Computer-Methusalems baff macht. Vom Pool aus,
mit Blick auf den Pazifik, ist Max mit seinen
Geschäften vor Ort. Ladys aus Tokio berichten
über den letzten Stand der Dreharbeiten,
gleichzeitig bedient der Herr über ein
Action-Imperium mehrere Standleitungen zur
Erforschung des Erfolgs.
 Die Wenders-Kamera geht ganz nah ran,
Bill Pullmans Gesichtszüge bilden ihre eigene
Landschaft, menschliche Reaktion versus Technik.
Auch die persönlichen Beziehungen sind nur noch
eine Frage der Handy-Frequenz. Max' Ehefrau Paige
(selten so schön fotografiert: Andie MacDowell -
Bild rechts) teilt vom Schlafgemach aus mit, daß
sie sich vom Gatten zu trennen gedenkt.
Dazwischen fiepsen alle verfügbaren Apparate zur
Bestätigung globaler Kommunikation. Die Wenders-Kamera geht ganz nah ran,
Bill Pullmans Gesichtszüge bilden ihre eigene
Landschaft, menschliche Reaktion versus Technik.
Auch die persönlichen Beziehungen sind nur noch
eine Frage der Handy-Frequenz. Max' Ehefrau Paige
(selten so schön fotografiert: Andie MacDowell -
Bild rechts) teilt vom Schlafgemach aus mit, daß
sie sich vom Gatten zu trennen gedenkt.
Dazwischen fiepsen alle verfügbaren Apparate zur
Bestätigung globaler Kommunikation.
Parallel zum Problem-Helden
Mike hat Wenders zusammen mit seinem wendigen
Drehbuchschreiber Nicholas Klein eine zweite
Männer-Figur erfunden, die dem Mike Max in
Haltung und Handlung zum Verwechseln gleicht.
Gabriel Byrne spielt den Programmierer Ray
Bering, der ein Oberservatorium zur
Überwachungszentrale ausgebaut hat und jedes Eck
von Los Angeles durchleuchtet. So erstickt man
die Kriminalität im Keim, meint das FBI. Sehr
vom letzten Stand, das Thema, auch wenn Wenders
– das macht den Film schon sympathisch
– keinen Kommentar zur inneren Sicherheit
vorlegt.
Allerdings legt der Regisseur
auch keine Gehschichte vor, an der der Zuschauer
Halt fände. Zustandsschilderungen in betörenden
und beklemmenden Bildern, geheimnisvolle Morde
über Video und Telefon zugespielt,
Systemstörungen, die den Fall vertuschen. Mike
Max wird zum Aussteiger und beobachtet von
draußen sein eigenes altes Leben, in dem
Studiokulissen den Bildern Edward Hoppers
nachgestellt sind. Da entgeht der kühle Wenders
nicht dem Hang zum romantischen Traum von der
Alternative, den ausgerechnet einer verwirklicht,
der gewinnträchtige Gewaltfilme produziert.
Ähnlich geht Wenders mit einer
anderen Figur um: Sam Fuller in der doppelten
Vaterrolle. Der Auftritt wurde zum Vermächtnis,
Fuller, Regisseur drastischer Actionfilme mit
Kultstatus, starb vor kurzem 85jährig. „Am
Ende der Gewalt“ zeigt ihn störrisch
altmodisch, eingeigelt in einem dunklen
Appartement, die Schreibmaschine partout nicht
gegen den Computer eintauschend – noch so
ein vieldeutiges Symbol im Wenders-Kosmos.
Begreiflicher wird der nicht
durch Kamera-Loopings über den Highways rund um
L.A., durch verästelte Krimi-Stränge und
unsichtbare Todesschüsse. Ohne schlüssige
Story, mit Einstellungen von großer Sogkraft
vermittelt Wim Wenders sein Bild einer total
konstruierten Welt, die vom Lebensgefühl einer
kleinen, aber dominanten Gruppe bestimmt wird.
Dem Industrielabor Hollywood eben. Ein Film für
Liebhaber visueller Belletristik. INGE RAUH
|
|