Kritik aus der   Leon
Gasts Leon
Gasts
Dokumentarfilm
'When we were Kings'
Mehr als
ein Champion

Am 30.Oktober 1974 ruhen alle Augen der
Welt auf Zaire, wo sich die Boxerlegenden Muhammad Ali
und George Foreman im Ring gegenüberstehen. 1967 sollte
Ali zu den in Vietnam kämpfenden US-Truppen eingezogen
werden. Der damalige Schwergewichts-Champion verweigerte
den Dienst, bekam Berufsverbot und mußte die Boxkrone
abgeben. Ali war zum Islam konvertiert und hatte sich zum
Sprachrohr der afro-amerikanischen Bewegung in den
Vereinigten Staaten gemacht.
Als er 1974 auf dem Höhepunkt von
Watergate- und Vietnam-Krise die Chance bekam, sich den
Titel zurückzuholen, war das nicht nur ein sportliches
Großereignis, sondern vor allem die Gelegenheit zur
Demonstration schwarzen Selbstbewußtseins. Der
schillernde und boxerisch brilliante Fighter kämpfte und
siegte überraschend gegen den patriotischen
„weißen“ Schwarzen George Foreman, der sich
vier Tage vor dem Kampf verletzte und damit für eine
sechswöchige Verschiebung des „Rumble in the
Jungle“ sorgte.
In diesen sechs Wochen entstand Gasts
Dokumentation über den Kampf des Jahrhunderts “When
we were Kings“, die nun nach 23 Jahren endlich
fertiggestellt werden konnte. Bereits in den ersten
Einstellungen aber ahnt man die politische Absicht des
Ali-Portraits, Gasts Versuch, den Traum der 70er Jahre
von der Einheit von Politik, Ästhetik und Sport
einzufangen. Von allem erzählt der Film etwas.
Gast montiert Orginalmaterial (Ali mit
Zaires Ex-Diktator Mubuto, Ali auf Pressekonferenzen und
mit seinen schwarzen Brüdern) und Interviews mit
Zeitzeugen. Leider bleibt die Dokumentation mit ihrem
hartgeschnittenen Feature an der Oberfläche und tendiert
deshalb leicht zur Langeweile. Vom Kampf der Boxgiganten
sieht man gar nur ein paar flirrende Bilder. rou
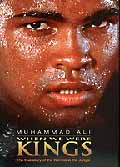
|
|
Kritik aus den  Er ist wie ein schlafender Elefant gewesen,
sagen seine Bewunderer. Man konnte um ihn herum alles
machen, aber wenn er aufwachte . . . Nein,
da wurde kein Mensch zum Tier: aber der Mann „legte
dem Blitz Handschellen an“ und „bändigte den
Donner“. Er tänzelte mit ungemein geschmeidigen
Schritten in den Wahnsinnskampf, er schlug zu, aber
dahinter steckten nicht nur Kraft oder Zerstörungswille.
Da war ein innerer Auftrag. Er boxte für sein Volk und
er sah sich selber als Werkzeug Gottes.
Am 30. Oktober 1974 taumelte im
Stadion von Kinshasa in Zaïre George Foreman auf den
Boden. Der Schwergewichtsweltmeister im Boxen war
plötzlich, nach einigen jener berüchtigten Rechten,
hinüber. Sein Gegner über ihm zog noch einmal auf, aber
er stockte: „Muhammad Ali wollte die Ästhetik des
Niedergangs nicht durch einen plumpen Schlag
stören“, sagte ein Reporter.
In dem Dokumentarfilm „When we
were Kings“, für den Leon Gast gerade einen Oscar
erhalten hat, kommt der legendäre Boxkampf nur am Rande
vor. Aber diese eine Szene und der Kommentar drücken
alles über den Mann aus, der längst – und nicht
allein als Sportler – zum Mythos geworden ist:
selten hatte ein schwarzer Star die gerechte Sache seiner
Brüder und Schwestern so vehement und lautstark, so
publikumswirksam vertreten. Und kaum zuvor hatte ein
farbiger Amerikaner so stolz an die Wurzeln erinnert:
„Wir haben Afrika in Ketten verlassen und kehren als
Champions zurück.“
Gast wollte 1974 eigentlich einen Film
über das Musik-Festival drehen, das mit schwarzen
Show-Größen wie James Brown, B. B. King oder
Miriam Makeba parallel zum Boxkampf geplant war. Als sich
Foreman beim Training verletzte, mußte das Sportereignis
um sechs Wochen verschoben werden: Künstler, Sportler
und Journalisten durften das Land nicht verlassen.
Schließlich sah Diktator Mobutu, der „verkappte
Sadist“, wie Norman Mailer ihn nennt, die große
PR-Show für sein Land. Die aber stahl dem Mann mit der
Pelzmütze, der vor dem Kampf noch schnell einige
Oppositionelle umbringen ließ, der große Muhammad Ali:
einmal mit seinen Tiraden gegen Foreman, aber mehr noch
durch seine offensichtliche Verbrüderung mit den
Afrikanern.
Ali wollte sportlich wieder nach oben,
und das verband er mit einem politischen Feldzug, der von
vielen Weißen verlegen belächelt wurde. Der Boxer hatte
in Amerika alle Titel verloren und war verurteilt worden
– wegen Wehrdienstverweigerung: gegen Vietcongs
wollte er nicht in den Krieg ziehen, schließlich hätten
die noch nie „Nigger“ zu ihm gesagt. Jetzt in
Afrika jubelten ihm Frauen, Männer und Kinder auf der
Straße wegen dieser Haltung zu. Sicher, auch Foreman war
ein Schwarzer: für Ali aber eben nur ein
„Amerikaner“, der zudem noch mit einem
deutschen Schäferhund nach Kinshasa reiste. Das
„Ali, bomaye!“ („Ali, töte ihn!“)
wurde für einige Wochen zum Schlachtruf eines ganzen
Volkes.
Leon Gast vermittelt etwas von der
explosiven Stimmung damals, die nicht nur im Ring
herrschte. Die Interviews, Konzert- und Kampfaufnahmen
mischen sich zu einem Dokument, das ganz subjektiv die
Hommage an einen außergewöhnlichen Menschen sein will,
der heute noch, gezeichnet von einer unheilbaren
Krankheit, über ein wunderbares Charisma verfügt: er
war „gut und schön“. Und Spike Lee fügt
hinzu: „Er ist ein Held für uns.“ Bernd
Noack
|

